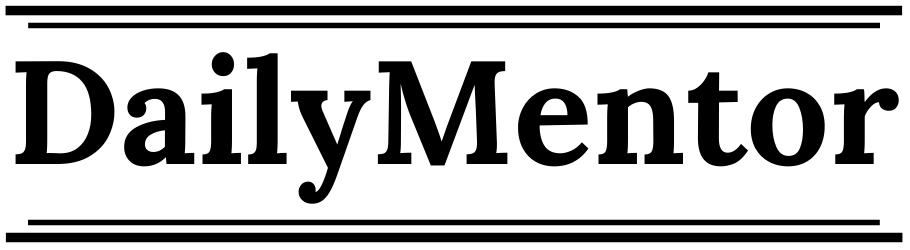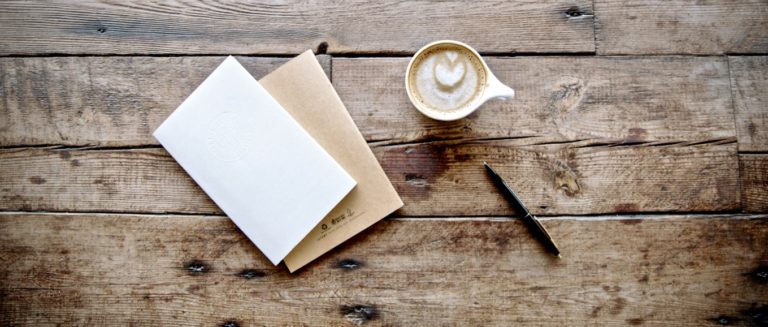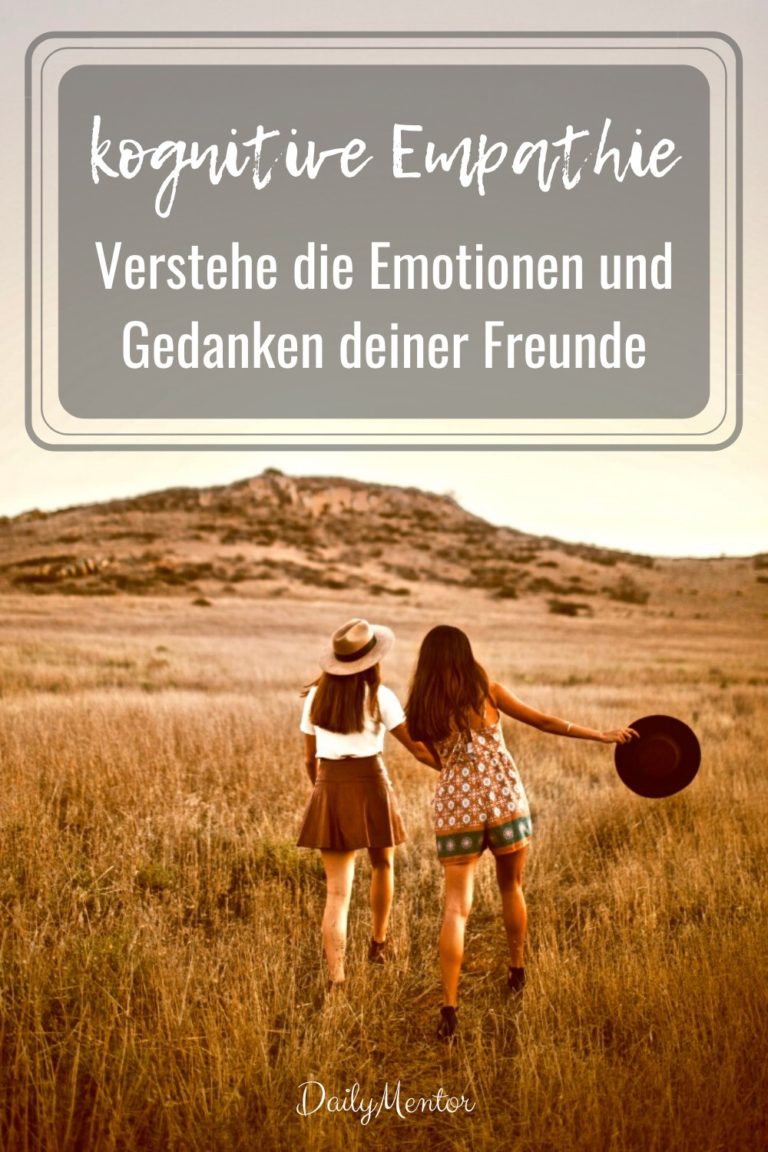Kennst du das Gefühl, wenn einem das tägliche Chaos über den Kopf steigt? Wenn einem der ganze Alltagsstress zu viel wird? Das tägliche Leben fordert uns jeden Tag mit neuen Aufgaben und Verpflichtungen, die zu erledigen sind. Abhilfe können gute Gewohnheiten schaffen, die einen für den Alltag gesünder, glücklicher, achtsamer und produktiver machen.
Du wirst mit Sicherheit unwissentlich schon viele Routinen in deinem Alltag entwickelt haben, die du gar nicht mehr als solche wahrnimmst und dir trotzdem dabei helfen, deinen Tag effizienter und besser zu gestalten. Neue Gewohnheiten können nicht nur dein Leben für die Zukunft erleichtern. Du kannst diese nämlich auch nutzen, um dich neuen persönlichen Herausforderungen zu stellen und dich neu zu entdecken.
Wir möchten uns 15 gute Gewohnheiten anschauen, die auch dein Leben bereichern können. Es gibt noch viele weitere dieser Art. Lass dich inspirieren und finde Gewohnheiten, die dir gut tun. Doch zuallererst sollten wir darüber sprechen, weshalb man gute Gewohnheiten entwickeln sollte und wie man am besten vorgeht, um diese erfolgreich umzusetzen.
Warum gute Gewohnheiten?
Wie es schon in den Wörtern “gute Gewohnheiten” steht, soll sich eine Gewohnheit positiv auf deinen Alltag ausüben. Mithilfe der etablierten Gewohnheit sollst du dich produktiver, glücklicher oder auch gesünder fühlen.
Wichtig ist dabei zu verstehen, dass du die Entscheidung für gute Gewohnheiten nicht nur für deine jetzige Situation fällst. Die Routine, die du entwickeln möchtest, soll dir auf langfristige Sicht einen Mehrwert schaffen. Aller Anfang kann schwer sein, wenn man sich dafür entscheidet eine neue Routine in seinen Alltag zu integrieren – manch eine Gewohnheit wird einen mehr Mühe machen als eine Andere. Daher solltest du überlegen, was dir in langfristiger Sicht gut tun könnte und wie du dein zukünftiges Leben gestalten möchtest.
Die Entscheidung, sich eine neue Gewohnheit anzueignen, kann auch als eine persönliche Herausforderung gesehen werden. Bringe dich bewusst in Situationen, mit denen du noch nicht so vertraut bist und dich neu fordern können. Scheue dich nicht vor dem Unbekannten und sehe es als Möglichkeit, dich neu zu entdecken, denn auch so etwas steuert deinem persönlichen Wachstum bei.
Falls du merkst, dass eine Gewohnheit, die du für dich getestet hast, nicht für dich bestimmt ist, ist das völlig in Ordnung. Probieren geht letztlich über Studieren. Du hast dich einer neuen Challenge gestellt und neue Einsichten erlangt. Dieser Situation solltest du definitiv was Positives abgewinnen können.
Gute Gewohnheiten bedeuten nicht nur neue Verhaltensweisen in deinem Leben zu etablieren, sondern ggf. auch auf schlechte Gewohnheiten zu verzichten. Das Verankern einer neuen Gewohnheit wird direkten Einfluss auf dein tägliches Leben haben. Du wirst womöglich alte Lebensweisen anpassen müssen. Der Verzicht oder die Anpassung dieser Routinen wird dich auch Dankbarkeit diese verspüren lassen. Schätze die Dinge und Lebensweisen, die du bereits führst, wert und verstehe, dass sie dir guttun.
Das richtige Vorgehen, um gute Gewohnheiten zu etablieren
Gute Gewohnheiten lassen sich nicht immer direkt von einem Tag auf den anderen erschaffen. Es benötigt eine gewisse Planung. Jeder von uns kennt das Gefühl anfänglicher Euphorie und dass man sich in diesem Stadium zu viel zutraut.
Eine gute Planung deiner gewünschten Gewohnheit ist daher nötig. Denn nicht jeder von uns startet mit denselben Voraussetzungen und Ressourcen – vor allem zeitlich gesehen. Abhängig davon, welche Routine du entwickeln möchtest, hat diese einen unterschiedlich großen Einfluss auf dein Leben und benötigt daher unterschiedlich viel Anstrengung und Ressourcen.
Du solltest dir daher überlegen, wie einnehmend die neue Lebensweise sein sollte und diese nach deinem Wohlbefinden und der dir zur Verfügung stehenden Zeit entsprechend skalieren. Gerade dann, wenn du dich in einem Gebiet erst neu ausprobierst, starte lieber etwas kleiner und taste dich an eine neue Gewohnheit heran.
Manch eine dieser guten Gewohnheiten lassen sich ggf. schneller in seinen Alltag integrieren und kosten nur fünf Minuten. Andere hingegen können eine Stunde oder gar mehr Zeit in Anspruch nehmen. Beurteile also deine zeitlichen Kapazitäten und ziehe diese in Betracht, wenn du dich für eine neue Gewohnheit entscheidest. Hast du wirklich genug Zeit und Energie dafür diese täglich ausführen zu können?
Relevante Themen, die mit guten Gewohnheiten korrelieren sind Selbstdisziplin, das Lernen von Zielformulierungen, und wie du deine Erfolge definieren solltest. Falls du weitere Handwerkszeuge und Tipps benötigst, um deine neuen Gewohnheiten erfolgreich zu gestalten.
Challenge: einen Monat für eine neue Gewohnheit
Neue Gewohnheiten in seinen Alltag einzubauen, kann sehr anstrengend sein und einem viel Kraft abverlangen. Versuche daher zu vermeiden, mehrere Gewohnheiten gleichzeitig zu etablieren. Ehe man sich selber übernimmt und gleich drei, vier, fünf Gewohnheiten gleichzeitig erlangen möchte, nimm dir jeden Monat eine neue Gewohnheit vor.
Diese Herangehensweise ist eine prominente Methode, um gute Gewohnheiten zu etablieren. Vorteil dieser Methode ist, dass du jeden Monat eine neue Gewohnheit testen kannst. Nach der einmonatigen Testphase kannst du dann beurteilen, inwiefern du einen Mehrwert durch die neue Gewohnheit generiert hast. Probiere die neue Gewohnheit während des Monats konsequent und mit der nötigen Disziplin aus, um zu schauen, ob dir diese wirklich gefällt.
Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist, dass man sich Stück für Stück neue Gewohnheiten aneignen kann. Man fokussiert sich einen Monat auf eine Routine. Im zweiten Monat nimmst du dir die nächste vor und hast ggf. die Gewohnheit aus dem ersten Monat bereits in deinem Alltag übernommen. Schritt für Schritt kannst du neue gute Lebensweisen in dein Leben integrieren, ohne dich selber zu übernehmen. Du wirst bemerken, dass nach der Zeit die Dinge einfacherer von der Hand gehen werden und du weniger Energie dafür benötigst.
Lass uns nun 15 Gewohnheiten anschauen, die auch dir im Alltag helfen können. Lass dich auf die einzelnen Inspirationen ein – und nun viel Spaß dabei!
15 Gute Gewohnheiten für deinen Alltag

1. Bücher lesen und Podcasts hören
Bücher und Podcasts geben dir für deinen Alltag einen großen Mehrwert. Es steht außer Frage, dass Lesen uns gut tut. Höre Podcasts und schau in ein Buch hinein über Themen, die dich interessieren und unterhalten. Die Auswahl ist riesig und du wirst mit Sicherheit fündig werden!
Podcasts sind seit einigen Jahren im großen Aufschwung. Es gibt zu jeglichen Themenbereichen Podcasts. Such doch mal in einer entsprechenden Podcast-App nach Themen, die dich interessieren und hör’ doch einfach mal rein. Großer Vorteil von Podcasts: Sie sind kostenlos, kannst sie dir einfach herunterladen und von überall hören.
Anstatt du auf dem Weg zur Arbeit, Uni oder Schule in der Bahn sitzt und auf dein Handy schaust, schnapp’ dir doch mal ein Buch und nutze die Fahrt um zu lesen. Genauso kannst du beim Autofahren einen Podcast hören oder auf ein Hörbuch zurückgreifen. Fahrzeiten, in denen du hauptsächlich “wartest“, bieten dir eine gute Möglichkeit diese Gewohnheit zu entwickeln.
Anstatt abends noch eine halbe Stunde am Computer oder vor dem Fernseher zu sitzen, kannst du dir auch dein Buch schnappen und noch ein wenig lesen. Gerade abends vor dem Schlafen gehen, sind Bildschirme für die Augen nicht gut. Unser Gehirn wird dadurch angestrengt und wir schlafen schlechter ein. Probier es doch mal einen Monat aus und setze dir das Ziel einen Monat lang eine halbe Stunde pro Tag zu lesen. Vielleicht findest du daran gefallen?

2. Ernährungsverhalten ändern
Es ist kein Geheimnis: Gesunde Ernährung ist sehr wichtig für unseren Körper – genauso auch für unseren Geist. Eine ausgewogene Ernährung macht uns gesünder und vitaler. Wir sind weniger anfällig für Krankheiten, fitter und können leistungsfähiger sein – körperlich und mental.
Eine ausgewogenere und gesunde Ernährung kann ein erster Schritt. Vielleicht findest du aber auch Gefallen an einer fundamentaleren Änderung deines Essverhaltens. Es gibt unterschiedliche Varianten des Vegetarismus und Veganismus. Informiere dich und vielleicht findest du eine Variante, die dir zusprechen könnte. Gute Gewohnheiten könnten sein auf Fleisch und ungesunde Fette zu verzichten, mehr Gemüse zu essen oder den Zuckerkonsum zu reduzieren. Probier es doch mal 30 Tage aus, sehe dann wie du dich fühlst und wie dein Körper auf dein neues Essverhalten reagiert.

3. Mehr Wasser trinken
Genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen, wird schnell vernachlässigt. Wir sprechen hier explizit von Wasser und keinen Säften, Softdrinks oder gar Alkohol. All diese Getränke haben viele versteckte Kalorien und unnötig viel Zucker. Wasser ist und bleibt mit Abstand die beste Option Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Als Alternative können wir dir auch ungesüßten Tee (den man auch kalt trinken kann) empfehlen, falls du nicht auf den Geschmack verzichten möchtest.
Der empfohlene Bedarf an Wasser kann nach Geschlecht, Größe, Gewicht und Alter variieren. Im Schnitt liegt die empfohlene Tagesmenge bei 2,5 Liter. Ein guter Wasserhaushalt ist für deinen Körper genauso wichtig wie ein gesundes Ernährungsverhalten. Genug Wasser zu trinken ist auch ein Schlüsselfaktor für deine Gesundheit. Wenn du Durst hast, lässt bspw. auch deine Konzentration nach.
Um deinen empfohlenen Tagesbedarf zu errechnen, findest du hier einen Rechner – und ein weiterer Tipp: lieber zu viel, als zu wenig Wasser trinken – gerade an warmen Tagen. Am besten schnappst du dir am Morgen deine Wasserflasche (optimalerweise eine Wiederverwendbare, sodass du keine Plastikwasserflaschen aus dem Supermarkt kaufst) und füllst diese mit Leitungswasser auf. Diese trinkst du bis zum Mittag aus und kannst das gleiche Prozedere für den Nachmittag und Abend machen.

4. Meditation oder Atemübungen
Steigere deine Achtsamkeit durch Meditation oder Atemübungen. Mit diesen Methoden schenkst du dir Zeit für dich. Gerade im stressigen Alltag ist es wichtig, sich regelmäßig zu besinnen. Meditation und Atemübungen helfen bei der Stressbewältigung und Selbstreflexion.
Für diese Art der guten Gewohnheiten können sogar schon fünf Minuten am Tag reichen. Du kannst die Zeit natürlich nach deinem eigenen Wohlbefinden nach oben skalieren. Schenke dir diese wertvolle Zeit. Es wird sich auszahlen und dir gut tun.
Falls du ein Anfänger auf diesem Gebiet bist, findest du im Internet hilfreiche Videos, die dich durch diese Übungen führen können. Du findest auch sehr gute Apps, die geführte Meditationen durchführen. Wir können dir die Apps Headspace oder Calm empfehlen.

5. Sport machen
Tue dir und deinem Körper was Gutes und mache Sport zu einer Routine in deinem Alltag. Wie auch schon in anderen Gewohnheiten erklärt, ist auch Bewegung ein Schlüsselfaktor, um gesund zu leben. Sport bietet dir zudem eine gute Möglichkeit den Alltagsstress hinter dir zu lassen und einfach mal den Kopf auszuschalten. Kennst du das gute Gefühl nach dem Sport, wenn man etwas geleistet hat und sich wohlfühlt? Dein Gehirn schüttet bei körperlicher Ertüchtigung Neurotransmitter aus, die man empfindet, wenn man glücklich ist.
Sport kann zeitaufwendiger sein, wenn man bspw. einen Mannschaftssport ausübt oder ins Fitnessstudio geht. Gleichzeitig sind dabei auch gewisse Kosten für Mitgliedsbeiträge verbunden. Es gibt aber auch Alternativen: kurze Home Workouts mit Körpereigengewicht oder sich die Laufschuhe schnüren und joggen zu gehen. Du findest viele kostenlose Apps, die dir Hilfestellung geben können.
Sport soll nicht nur anstrengend sein. Sieh es nicht als bösartige Verpflichtung, denn Sport soll und kann auch Spaß machen. Keiner verlangt von dir, dass du täglich zwei Stunden im Fitnessstudio stehst und dich durch dein Training quälst. Eine Studie der WHO empfiehlt für Erwachsene mindestens 150 Minuten Sport die Woche zu betreiben.
Aller Anfang kann schwer sein – gerade dann, wenn es sich um körperliche Anstrengung handelt. Wichtig ist es mit Disziplin am Ball zu bleiben. Vielleicht hilft es dir die Gewohnheit mit einem Freund oder deinem Lebenspartner zu etablieren. So etwas kann schnell helfen. Über soziale Medien oder in deiner Stadt gibt es bestimmt auch Angebote für Gruppenworkouts, wo man sich bspw. in einem Park trifft, um gemeinsam Sport zu treiben.
Es gibt unzählige Sportarten. Du wirst bestimmt eine finden, die dir Spaß macht – sei es eine Einzelsportart oder eine, die du mit anderen zusammen machen kannst. Sportcenter bieten dir zudem oft die Möglichkeit nötiges Equipment auszuleihen, wenn du in eine neue Sportart mal reinschnuppern möchtest.

6. Deiner Passion nachgehen
In unserem Alltag forcieren wir oftmals den großen Erfolg und unsere formulierten Ziele. Wir wollen uns stetig weiterentwickeln und vorankommen. Deine Passionen und Hobbys solltest du dabei trotzdem nicht vernachlässigen.
Gute Gewohnheiten müssen dich nicht immer nur produktiver und besser machen, sondern auch einfach mal nur glücklich. Etabliere in deinen Alltag Gewohnheiten, wo du deinen Leidenschaften nachgehen kannst, die dich persönlich erfüllen. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Was sind deine Hobbys oder welche Projekte verfolgst du außerhalb deines Alltags?
Es ist auch nie zu spät neue Dinge ausprobieren. Teste dich in unterschiedlichsten Dingen wie Schreiben, Malerei, Fotografie, Kochen oder lerne ein Instrument.
Schenke dir selber regelmäßig Zeit für deine Passionen. Denn es sind auch diese Dinge, die wichtig in unserem Leben sind, uns als Person ausmachen und glücklich stellen. Erfolg und Karriere im Leben sind nämlich nicht alles.

7. Eine Morgen- und/oder Abendroutine entwickeln
Mit einer Morgen- und Abendroutine kannst du dir den Start in den Tag oder den Gang ins Bett erleichtern. Bei dieser Art von guten Gewohnheiten spricht man auch von “Keystone Habits“ (übersetzt Grundpfeiler Gewohnheiten). Diese Gewohnheiten integrieren weitere Routinen.
Wenn du dir eine Morgenroutine aufbaust, kann diese eine zehnminütige Meditation, einen Tee trinken und eine warme Dusche beinhalten, die damit auch zur Gewohnheit werden. Du sollst dir einen angenehmen Start in den Tag ermöglichen, damit du diesen erfolgreich bestreiten kannst. Abends findest du Zeit für dich, bringst dich zur Ruhe und entwickelst eine Routine für einen besseren Schlaf.
Überlege dir welche drei Dinge du in deinen Morgen bzw. Abend einbauen kannst, die dir für die Tageszeit einen Mehrwert schaffen können.

8. Konsumverhalten ändern
Wir leben in der heutigen Zeit in einer Konsumgesellschaft. Überall werden wir mit Werbungen und Marketingstrategien unterschiedlichster Unternehmen konfrontiert, die wollen, dass wir Geld ausgeben.
Materialismus und die persönliche Identifikation durch Besitz ist in unserer heutigen Zeit sehr präsent. Mit einem besseren Konsumverhalten sollst du dir über den Wert deiner Konsumgüter bewusster werden – der nicht nur das Preisschild beinhaltet.
Etwas, das du dir kaufst, hat nicht nur einen monetären Wert, sondern auch einen Persönlichen. Schätze diese Dinge mehr wert, die du besitzt und kaufst. Versuche dich weniger durch Rabattschilder und anderen Aktionen und zu einem Kauf verlocken. Stattdessen werd dir bewusst, was du wirklich benötigst und nicht nur gerne haben möchtest. Genauso funktioniert nämlich Werbung: Wir sollen ein Gefühl des Verlangens entwickeln, dass wir diese Sache unbedingt benötigen und uns schlussendlich kaufen.
Bei deinem Einkauf solltest du darauf achten nicht nur Dinge zu kaufen, die einen im temporären Status glücklich machen sollen. Menschen kaufen nämlich Dinge, um sich glücklich zu fühlen, um Unzufriedenheiten zu kompensieren. Diesen Grundgedanken findest du in der Lebensweise des Minimalismus wieder. Verstehe die Wertigkeit hinter deinem Besitz und hinterfrage dich beim nächsten Einkauf, ob du die Dinge wirklich benötigst.
Ein weiter Vorteil, wenn du dein Konsumverhalten anpasst: Du wirst Geld sparen. Dies bringt uns gleichzeitig zum Punkt 9 unserer guten Gewohnheiten.

9. Sparen
Es kann nie zu früh sein mit dem Sparen anzufangen. Dem einen ist es mehr möglich, dem anderen weniger. Es ist egal, welche Summe du sparen möchtest, denn hierbei zählt der Grundgedanke. Denn auch wenn es nur 50 € im Monat sind, die du zur Seite legen kannst, sind das nach zehn Jahren 6.000 € – ohne Verzinsung.
Jeder sollte einen gewissen finanziellen Puffer haben oder diesen aufbauen. Es kommen nämlich auch mal schlechte Zeiten, auf die wir nicht eingestellt sein können, bspw. wenn das Auto eine Reparatur benötigt. Finanzielle Rücklagen können uns dabei helfen. Dein Erspartes solltest du auch wirklich nur dann anfassen, wenn es wirklich nötig ist und nicht nur, weil du gerade knapp bei Kasse bist, weil du den Monat etwas spendierfreudiger gelebt hast. Als Faustregel wird davon gesprochen drei bis vier Nettogehälter als Rücklage zu besitzen.
Sparen kann zudem schnell vereinfacht werden, dass dies sozusagen passiv passiert ohne, dass du dafür noch was machen musst. Richte dir einen Dauerauftrag auf deinem Lohnkonto ein, welcher einen bestimmten Betrag auf dein Sparkonto überweist. Du musst also nichts weiter dafür machen. Wenn das Geld direkt am Monatsanfang dein Konto verlässt, nimmst du dir selber die Möglichkeit dieses auszugeben. Du rechnest gleich mit einem anderen monatlichen Budget.
Finanzielle Bildung – sprich der Umgang mit Geld und Kapitalanlagen – ist sehr wichtig. Grundkonzepte können schnell erlernt werden. Du findest im Internet viele hilfreiche Tipps und Videos. Wir empfehlen dir, dass du dich daher mit diesem Thema ein wenig beschäftigst und dir Gedanken über dein erarbeitetes Geld machst.

10. Entrümpeln
Besitz kann belasten. Jeder von uns besitzt unzählige Sachen. Über die Zeit häufen sich in unserer Wohnung immer mehr und mehr Dinge an, ohne das gleichzeitig aussortiert wird. Die Kommode und der Kleiderschrank platzen an Kleidungsstücken und die Schränke sind zugestopft bis auch der letzte Stauraum genutzt wurde.
Nicht nur zum Frühjahrsputz sollte der eigene Lebensbereich sauber gemacht werden, sondern in viel regelmäßigeren Abständen. Menschen bauen persönliche Bindungen zu Dingen auf und können sich dann nur noch schwer von diesen trennen. Bei gewissen Dingen ist dieses Verhalten auch richtig, jedoch nicht immer. Unnötige Nostalgie für den persönlichen Besitz sollten wir trotzdem nicht verspüren.
Schau dich einmal in der Wohnung um und überlege, welche Dinge ggf. keine Daseinsberechtigung mehr haben. Nimm sie in die Hand und schaue was du dabei spürst. Du musst die Sache nicht zwingend direkt ausmisten. Verstaue sie in einem Karton und schaue, ob du sie – mit der Zeit – nach ein paar Wochen vermisst. Falls ja, solltest du es behalten. Andernfalls solltest du dich davon trennen.
Starte gerne klein: Am ersten Tag machst du es mit einer Sache, am Zweiten dann zwei und so weiter. Du wirst merken, wie befreit man sich fühlt, wenn man sich von unnötigen Besitz getrennt hat. Ein sehr inspirierender Spielfilm, der sich mit seinem persönlichen Besitz beschäftigt ist 100 Dinge mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz. Wir können dir diesen Film sehr empfehlen, da man hierbei Lebensweisheiten auf sein Leben anwenden kann.

11. Social Media Detox
Social Media ist kaum noch wegzudenken in unserer heutigen Zeit. Der Griff zum Smartphone, um die sozialen Netzwerke nochmal zu checken, ist sehr verlockend, wenn man auf seine Bahn wartet oder gerade nichts zu tun. Ergibt sich aus dieser Zeit ein gewisser Mehrwert für dich?
Du musst nicht zwingend auf jedes Medium verzichten oder gar deine Konten löschen, sondern solltest eher deinen Zugriff auf diese Netzwerke bewusster nutzen. Das Checken von Social Media ist in eine Art der Prokrastination und des unnötigen Zeitvertreibs.
Der stetige Vergleich durch die sozialen Netzwerke kann uns neidisch machen, wenn wir uns das Leben anderer Leute durch die digitalen Filter anschauen. Gleichzeitig haben einige das Gefühl von Angst etwas zu verpassen. Doch es kann sehr befreiend wirken auch mal nicht zwanghaft immer erreichbar zu sein. Nutze doch mal den Zeitpunkt und überprüfe in deinen Handyeinstellungen wie viel Zeit du am Tag in den sozialen Netzwerken unterwegs bist. Diese Einsicht kann für manch einen erschreckend sein.
Als ein Vorschlag kannst du die Apps von deinem Handy deinstallieren und loggst dich ein- bis zweimal am Tag von deinem PC zu Hause ein. Ich nutze Facebook bspw. gar nicht mehr und schaue alle paar Tage von Laptop nur noch rein. Ich vermisse Facebook nicht und habe auch nicht das Gefühl, irgendwas zu verpassen.
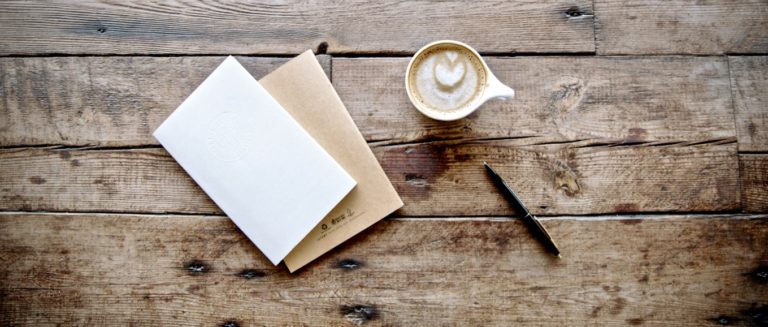
12. Tagebuch schreiben und Selbstreflexion führen
Eine tägliche Art der Selbstreflexion verhilft dir für deine persönliche Entwicklung. Werde dir in regelmäßigen Abständen über deine Ziele und Visionen bewusst. Genauso können dir mit dieser guten Gewohnheit negative Verhaltensweisen auffallen, die dir so noch gar nicht bewusst waren.
Finde eine gute Methode dich selbst zu reflektieren. Dafür können schon ein paar Minuten am Tag ausreichend sein. Bevor du dich ins Bett legst, kannst du deinen Tag Revue passieren lassen.
Manch einer kann dies im Kopf machen. Andere schreiben gerne eine halbe Seite in ihr Notizheft oder Tagebuch. Keiner verlangt von dir, dass du dir dafür eine halbe Stunde nehmen musst. Es geht vorrangig darum, dass du deine Achtsamkeit steigern kannst.

13. Früh aufstehen
Schlaf ist wichtig. Je nach Alter und Geschlecht solltest du darauf achten zwischen sechs und neun Stunden Schlaf zu bekommen. Jeder kennt trotzdem die Situationen, wenn man sich abends die Zeit vertreibt mit Social Media, dem Fernseher oder anderen Tätigkeiten.
Probier es doch mal diesen Zeitvertreib in produktive Stunden am Morgen umzulegen. Anstatt bis 1:00 wach zu bleiben, Netflix zu schauen und dann am Morgen erst nach 10:00 aufzustehen, kannst du dich zu 23:00 ins Bett legen und um 8:00 erholt und frisch in den neuen Tag starten. Versteh es nicht falsch: Erholung ist wichtig und auch mal nichts zu tun, ist bis zu einem gewissen Maß völlig in Ordnung. Überlege dir trotzdem mal, was du mit dieser “geschenkten Zeit“ alles anfangen könntest.
Solltest du das Privileg der Gleitarbeitszeit nutzen können oder kannst generell deinen Alltag sehr variabel gestalten. Werde dir über deine verfügbare Zeit bewusst und wie du diese am produktivsten nutzen kannst.

14. Einen Kalender führen
Mit einem Kalender führst du eine bessere Struktur in dein Leben ein. Plane deine bevorstehenden Vorhaben und Treffen schneller und einfacher. Dafür kannst du ein Notizheft oder Kalender in klassischer Form mit dir tragen oder eine der vielzähligen Kalender Apps nutzen. Die Termine sind in Sekundenschnelle gemacht und du kannst von überall Zugriff auf deinen Kalender haben.
Das was in der Arbeitswelt funktioniert, wo jeder einen Kalender führt, kann auch in deinem privaten Leben funktionieren. Ich führe einen Kalender mit der Google App mittlerweile schon etwas länger und finde es sehr nützlich.
Mit Hilfe deines Kalenders kannst du schnell die Ereignisse der kommenden Tage einsehen und somit deinen Alltag besser planen. Vermeide Stress und werde dir bewusster über deine zur Verfügung stehende Zeit.

15. Laster ablegen
Genauso wie man gute Gewohnheiten in seinen Alltag integrieren kann, sollte man auch darauf achten schlechte Gewohnheiten zu verbannen. Denn auch so etwas kann als gute Gewohnheit gelten.
Jeder von uns hat seine Marotten und Laster, die man gerne ablegen möchte. Eine der typischsten schlechten Gewohnheiten ist der Alkoholkonsum oder das Rauchen. Vielleicht fallen dir aber auch Charaktereigenschaften auf, die du gerne ändern oder ablegen würdest.
Bestehende Gewohnheiten sind schwer abzulegen. Es benötigt dafür ein gutes Durchhaltevermögen, Disziplin und Charakterstärke. Versuche die richtige Motivation zu finden, die dir dabei helfen kann entsprechende Lebensweisen abzulegen und lass dir gerne von deinem Familien- und Freundeskreis dabei helfen.
Unser Schlusswort zu guten Gewohnheiten
Wir hoffen, du konntest ein wenig Inspiration für dich finden und versuchst einige dieser guten Gewohnheiten für dich aus. Lasse dich auf die neuen Lebensweisen ein und gebe ihnen eine Chance, dass sie ein Bestandteil deines Alltags werden können. Jede einzelne Gewohnheit kann dir einen positiven Mehrwert schaffen, dich glücklicher, achtsamer, gesünder oder produktiver machen.
Welche Gewohnheit möchtest du für deinen Alltag ausprobieren oder hast es sogar gemacht? Wie bist du vorangekommen und was waren deine Erfolge damit? Wir freuen uns über deine Erfahrungen!